Der Tagebau Hambach ist mit einer Fläche von 85 km² die größte Braunkohlegrube in Europa. In den letzten Jahren hat er erhebliche Aufmerksamkeit in der Wissenschaft, Öffentlichkeit und Politik erregt. Im Jahre 2030 soll mit dem Braunkohleabbau Schluss sein. Doch wie wirkt sich der Abbau der Braunkohle auf die Region und die Energieversorgung Deutschlands aus?
Inhalte
Informationen zum Tagebau
Der Tagebau Hambach befindet sich im rheinischen Braunkohlerevier, welches das größte Braunkohleabbaugebiet in Deutschland darstellt und sich in der Niederrheinischen Bucht zwischen den Städten Aachen, Köln und Mönchengladbach befindet. Jährlich werden in den bis zu 400 Meter tiefen Tagebauen dieses Gebiets etwa 60 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert.¹ Es gibt zwei weitere nennenswerte Braunkohlereviere in Deutschland. Im Jahre 2022 wurden im Mitteldeutschen Braunkohlerevier rund 17 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert.² Im Lausitzer Revier waren es im selben Jahr etwa 49 Millionen Tonnen.³
Der Hambacher Tagebau, in dem seit 1978 Braunkohle gefördert wird, wird von der RWE Power AG betrieben. Im Jahre 2030 soll der Betrieb eingestellt werden.
Im Rheinischen Revier findet man mit den Tagebauen Garzweiler, Hambach und Inden aktuell drei Großtagebaue. Sie werden vom Energieversorger RWE betrieben. Jeder Tagebau ist terrassenförmig angelegt. Die Kohle wird überwiegend in den unteren Terrassen (Sohlen) gewonnen. Dort tragen bis zu 240 Meter lange und 96 Meter hohe Schaufelradbagger sowohl Abraum (über der Kohle liegende Schichten aus Löß, Sand, Kies, Ton) als auch Kohle ab (Abbauzone).

Von Thomas Römer/OpenStreetMap data, CC BY-SA 2.0, Link
Der abgetragene Abraum wird über Förderbänder auf die gegenüberlegende Seite des Tagebaus befördert und dort von den sog. „Absetzern“ aufgeschüttet (Verkippungszone). Auf diese Weise wandert der Tagebau im Laufe der Zeit.³ Die Kohle wird schließlich, ebenfalls über Förderbänder bzw. Gleise, in die nahegelegenen Braunkohlekraftwerke und Veredlungsbetriebe transportiert.




Wirtschaftliche Auswirkungen
Arbeitsplätze
Eine der unmittelbarsten Auswirkungen ist die Beschäftigungswirkung. Mit etwa 1.500 direkt Beschäftigten⁴ trägt der Tagebau Hambach maßgeblich zum lokalen Arbeitsmarkt bei, besonders in den Gemeinden Niederzier und Elsdorf. Diese Arbeitsplätze reichen weit über den eigentlichen Kohleabbau hinaus und umfassen auch Bereiche wie die Instandhaltung und Wartung der Maschinen und Fahrzeuge im Tagebau, der Logistik sowie der Verwaltung. Der wirtschaftliche Einfluss des Tagebaus Hambach erstreckt sich jedoch auch weit über die direkte Schaffung von Arbeitsplätzen hinaus. In den umliegenden Gemeinden hat sich ein Netzwerk aus Zulieferern und Dienstleistern entwickelt, die alle vom Tagebau profitieren. Untersuchungen ergaben, dass rund 14.400 Arbeitsplätze wegfallen werden, wenn die Kohlekraftwerke ihren Betrieb einstellen. Gleichzeitig sollen jedoch – unterstützt durch Investitionen der Bundesregierung – bis 2038 zusätzliche 27.000 neue Arbeitsplätze im Rheinischen Revier entstehen.⁵
Energiesicherheit
Der Tagebau Hambach spielt auch eine wichtige Rolle in der Energiesicherheit Deutschlands. Braunkohle ist eine der Hauptenergiequellen Deutschlands und unterstützt die Energiegewinnung, insbesondere in Zeiten, in denen erneuerbare Energien wie Wind und Sonne nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Auch, wenn der Anteil der Kohle am deutschen Strommix in den vergangenen Jahrzehnten konstant zurückgeht, betrug er 2023 immer noch rund ein Viertel. Steinkohle trugt dabei 2023 zu einer Stromeinspeisung von ca. 36 TWh bei, Braunkohle zu 77,5 TWh. Kohle gewährleistet demnach bis heute eine kontinuierliche und stabile Energieversorgung Deutschlands. Jedoch trägt sie auch maßgeblich zu den CO2-Emissionen Deutschlands bei. 50 Prozent aller CO2-Emissionen der deutschen Stromproduktion sind auf die Braunkohle zurückzuführen.¹⁶
Hintergrund der Entwicklung, dass der Anteil der Kohle an der Stromproduktion Deutschlands zurückgeht, ist die Energiewende in Deutschland mitsamt des Ausstiegs aus der Atomenergie und dem verstärkten Einsatz erneuerbarer Energien, welche durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gefördert werden. Dadurch wird garantiert, dass Strom aus erneuerbaren Quellen bevorzugt ins Stromnetz eingespeist wird. Zusätzlich verteuern jährlich steigende Preise für CO2-Zertifikate den Strom aus fossilen Rohstoffen. Ausgehend von den CO2-Zertifikatspreisen im Jahre 2018 handelt es sich bei Braunkohle dennoch um einen der günstigsten Energieträger zur Stromerzeugung.¹⁴ Am 03. Juli 2020 beschlossen Bundestag und Bundesrat den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis zum Jahr 2038. Im Koalitionsvertrag der Ampel-Regierung von 2021 wurde festgelegt, dass der Kohleausstieg im Optimalfall bereits 2030 erfolgen soll. Mit dem Kohleausstieg versucht die Bundesregierung, die Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens einzuhalten und bis 2050 klimaneutral zu werden.

Ökologische Auswirkungen
Staubbelastung
Die Staubbelastung durch den Tagebau Hambach ist ein bedeutendes Umweltproblem, das die Gesundheit der Menschen in der Umgebung beeinträchtigt. Untersuchungen im Auftrag des BUND⁶ ergaben, dass der Tagebau Hambach mit einem Anteil von 11% den größte lokalen Verursacher der Feinstaubbelastung in Niederzier darstellt obwohl seit 2012 Maßnahmen zur Einhaltung der Grenzwerte ergriffen wurden. Kann man Daten aus US-amerikanischen Studien auf Deutschland übertragen, was jedoch noch nicht zuverlässig abgeschätzt werden kann, wäre der Tagebau Hambach für höhere Feinstaub-Emissionen verantwortlich als alle Stein- und Braunkohlenkraftwerke in Nordrhein-Westfalen zusammen. Hierbei wird von einer Jahreskohleproduktion von etwa 40 Millionen Tonnen und einem Abraum von 250 Millionen Tonnen ausgegangen. Dadurch ergibt sich ein täglicher Feinstaub-Austrag aus dem Tagebau von mehr als 130 Tonnen. Bezogen nur auf die Kohleförderung würden jährlich etwa 6.700 Tonnen Feinstaub emittiert.⁶ Zudem ist jede Tonne Abraum mit 0,8 Gramm Uran belastet, was den Feinstaub radioaktiv macht.⁷
Infolgedessen werden die Schadstoffe kontinuierlich überwacht. Außerdem ist ein Luftreinhalteplan zur Einhaltung der geltenden Grenzwerte ist in Kraft getreten. Durch verschiedene Maßnahmen im Tagebau konnte die Belastung durch Feinstaub zwar gesenkt werden, jedoch ist eine vollständige Entwarnung noch nicht möglich. Dazu gehören Maßnahmen wie das Anpflanzen von Bäumen auf der Abraumseite, das Befestigen von Straßen und Bandanlagen, das Berieseln von Kohlebunker und Kohlebändern sowie das Aufsprühen von Wasser beim Baggern, um Staub zu binden.
Neben der Staubbelastung kommt es auch zu einer erheblichen Licht- und Lärmemissionen durch den Tagebau.
Grundwasserabsenkung
Um die Kohle in Tiefen von bis zu 400 Metern abzubauen, muss permanent das Grundwasser abgepumpt werden, welches ansonsten in den Tagebau einsickern würde. Man spricht hierbei von „Sümpfung“. Das Wasser wird anschließend in die Vorfluter in der Region geleitet. Die Grundwasserstände werden dadurch im weiten Umkreis beeinflusst. In einem Radius von bis zu 20 Kilometern kommt es zur Absenkung des Grundwassers, welches Feuchtgebiete und Wälder nachhaltig schädigen kann.¹² RWE versucht, diesen Nachteilen mit Renaturierung und Ausgleichsmaßnahmen entgegenzuwirken.
Die Grundwasserabsenkung im Rahmen des Tagebaus Hambach hat sowohl ökologische als auch soziale Auswirkungen hat. Seit Beginn des Tagebaus im Jahr 1978 wird das Grundwasser in der Region großflächig abgesenkt, um die Trockenlegung des Tagebaus zu ermöglichen. Die Entwässerung dringt dabei bis in Tiefen von 550 Metern vor und hat zur Folge, dass es Jahrhunderte dauern wird, bis sich nach Beendigung der Tagebautätigkeiten wieder natürliche Grundwasserverhältnisse einstellen.
Im Jahr 2021 wurde insgesamt 296 Millionen Kubikmeter Wasser gehoben, wobei die erlaubte jährliche Grundwasserhebung und -ableitung bei bis zu 450 Millionen Kubikmetern liegt.⁸ Durch diese massive Grundwasserabsenkung können Feuchtgebiete trockenfallen, sich der Verlauf von Fließgewässern verändern und die lokale Wasserqualität beeinträchtigt werden. Darüber hinaus hat die Grundwasserabsenkung auch soziale Konsequenzen, wie die Beeinträchtigung der Wasserversorgung für die lokale Bevölkerung und Landwirtschaft.
Flächenverbrauch
Seit dem Aufschluss des Tagebaus 1978 hat der Abbau der Braunkohle in der Niederrheinischen Bucht massive Landschaftsveränderungen mit sich gebracht. Die ursprünglich geplante Abbaufläche umfasste bis zu 85 Quadratkilometer, wobei die Abbaugeräte in Tiefen von über 450 Metern vordringen sollten. Bis zum Ende des Jahres 2021 wurden etwa 6.230 Hektar Landschaft für den Tagebau in Anspruch genommen. Die Betriebsfläche selbst erstreckte sich über etwa 4.570 Hektar - dies entspricht 6.134 Fußballfeldern. Von dieser Fläche wurden bis Ende 2021 etwa 1.660 Hektar rekultiviert und wieder nutzbar gemacht. Diese Zahlen verdeutlichen das Ausmaß des Flächenverbrauchs und der Landschaftsveränderungen durch den Tagebau.
Für hohe Aufmerksamkeit in den Medien sorgte die geplante weitere Abholzung des Hambacher Forsts 2018, der seitdem zu einem Symbol des Widerstands gegen die Braunkohle geworden ist Hierbei handelt es sich um ein einst 4100 Hektar großes Waldgebiet, das seit den 1970er Jahren für den Braunkohletagebau erheblich reduziert wurde. Im Jahr 2018 plante RWE, die verbliebenen 200 Hektar auf unter 100 Hektar zu reduzieren, was zu erheblichen Auseinandersetzungen führte. Die Abholzung hätte die Zerstörung gewachsener Ökosysteme mit mitunter vom Aussterben bedrohten Tierarten bedeutet. Hierzu zählt u.a. die Bechsteinfledermaus, welche den Hambacher Forst mit zwei Kolonien bewohnt.⁹ Die nordrhein-westfälische Landesregierung ordnete die Räumung der Baumhäuser aus Brandschutzgründen an, was später als rechtswidrig eingestuft wurde. Nach einem vorläufigen Rodungsstopp durch das Oberverwaltungsgericht Münster und einer Großdemonstration mit ca. 50.000 Teilnehmern wurde die Räumung eingestellt. Im Jahr 2020 beschloss die Bundesregierung den Erhalt des Hambacher Forsts.

Widerstand gegen die Abholzung des Hambacher Forst im Jahre 2018
By MaricaVitt, CC-BY-SA 4.0
Soziale Auswirkungen
Auch erfordert der Braunkohleabbau die Umsiedlung ganzer Dörfer. Seit den 1950er Jahren wurden im Rheinland rund 40.000 Menschen umgesiedelt.¹⁰ Zwar ist RWE gesetzlich verpflichtet, Ausgleichszahlungen zu leisten, jedoch entsprechen diese mitunter nicht den Vorstellungen der Betroffenen.¹¹
Die Umsiedlung von Gemeinden aufgrund des Tagebaus Hambach ist ein tiefgreifender Prozess, der das Leben vieler Menschen grundlegend verändert hat. Ein markantes Beispiel ist das Dorf Manheim, das durch den Braunkohletagebau Hambach komplett umgesiedelt werden musste. Die Planungen für die Umsiedlung von Manheim begannen bereits in den 1980er Jahren, und der Prozess ist bis heute nicht vollständig abgeschlossen. Das Dorf, das erste Mal urkundlich im Jahre 898 erwähnt wurde und tief verwurzelten Gemeinschaftsstrukturen aufwies, musste einem neuen Ort weichen, der als Manheim-neu bekannt ist. Dieser neue Ort wurde speziell für die umgesiedelten Bewohner entwickelt und liegt einige Kilometer vom ursprünglichen Standort entfernt. Die Umsiedlung umfasste nicht nur den Transfer von Wohnhäusern, sondern auch von Infrastruktureinrichtungen wie Schulen, Kirchen und Geschäften.
Ein weiteres Dorf, das von der Umsiedlung betroffen war, ist Morschenich. Ähnlich wie in Manheim mussten die Einwohner ihre Häuser verlassen und in einen neu errichteten Ort umziehen. Die emotionale und soziale Belastung für die betroffenen Menschen ist enorm, da sie gezwungen sind, ihre Heimat, ihre Erinnerungen und oft auch einen Teil ihrer Identität zurückzulassen.
Bereits Jahre or der Umsiedlung kommt es zu allmählicher Verödung der Ortschaften, da aufgrund fehlender Perspektiven potenzielle Kunden bzw. Investoren und Unternehmer Abstand nehmen. Die Bilder zeigen den Elsdorfer Ortsteil Tollhausen. Die Elsdorfer Ortsteile Etzweiler, Tanneck, und die Siedlung Gesolei mussten dem Tagebauh bereits weichen.


Auf der anderen Seite kann es sich bei den neuen, am Reisbrett geplanten Dörfern jedoch gegebenenfalls um lebenswerte Orte handeln, welche infrastrukturell hervorragend erschlossen sind. Die nachfolgenden Fotos zeigen den Kerpener Stadteil Manheim-neu, der als Resultat des Braunkohlentagebaus Hambach durch den RWE-Konzern entstand. Der alte Ort Manheim, das erste Mal urkundlich im Jahre 898 erwähnt, muss bis 2024 komplett weichen. In Manheim-neu wohnen - Stand 2020- rund 1.400 Personen.








Die folgenden Bilder zeigen den alten Ort Manheim im Jahr 2024, welcher noch in diesem Jahr weichen soll (Stand Mai 2024).


Fazit
Die Förderung der Braunkohle im Tagebau Hambach hat weitreichende wirtschaftliche, ökologische und soziale Auswirkungen. So trägt er maßgeblich zur Wirtschaftsleistung der Region bei und sorgt für eine stabile Stromversorgung. Jedoch stellt beispielsweise die Staubbelastung ein erhebliches Umweltproblem dar, trotz Maßnahmen zur Reduzierung. Die Grundwasserabsenkung hat Einfluss auf Feuchtgebiete und Wälder im Umkreis von 20 Kilometern. Hinzu kommt der enorme Flächenbedarf des Tagebaus, was zur Umsiedlung von Dörfern wie Manheim und Morschenich führt. Dies wiederum bringt soziale Herausforderungen mit sich, zeigt aber auch das Potenzial neuer, gut erschlossener Siedlungen.

Quellen
¹ BUND Nordrhein-Westfalen [Hrsg.] (o. J.): Braunkohletagebau im Rheinland. Düsseldorf
² Statista (2023): Braunkohleförderung in Mitteldeutschland. Hamburg.
³ Statista (2023): Braunkohleförderung in der Lausitz. Hamburg
⁴ Rathman, M. (2022): Tagebau Hambach: Braunkohleabbau und Protest-Symbol. Hamm.
⁶ BUND Nordrhein-Westfalen [Hrsg.] (2019): Braunkohle und Gesundheit. Düsseldorf.
⁷ RP Digital GmbH (2006): Gesundheit durch Staub und Strahlung in Gefahr. Düsseldorf
⁸ BUND Nordrhein-Westfalen [Hrsg.] (o. J.): Braunkohletagebau Hambach. Düsseldorf
¹⁰ BUND Brandenburg [Hrsg.] (o. J.): Gewässerverschmutzung durch Tagebaue. Potsdam.
¹¹ Först, M. (2019): „RWE zerstört gerade, wie wir in Zukunft leben sollten. Düsseldorf.
¹³ Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (Hrsg.) (2023): Von der Kohle zur Zukunft. Berlin.
¹⁵ DEBRIV [Hrsg.] (2013): Braunkohle in Deutschland – Profil eines Industriezweigs. Köln.
¹⁶ Haug, C. (2018): Braunkohle: Stromversorgung und Umweltschäden. Leipzig.





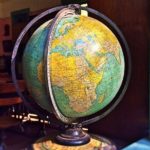



Ein Kommentar
Kommentare sind geschlossen.